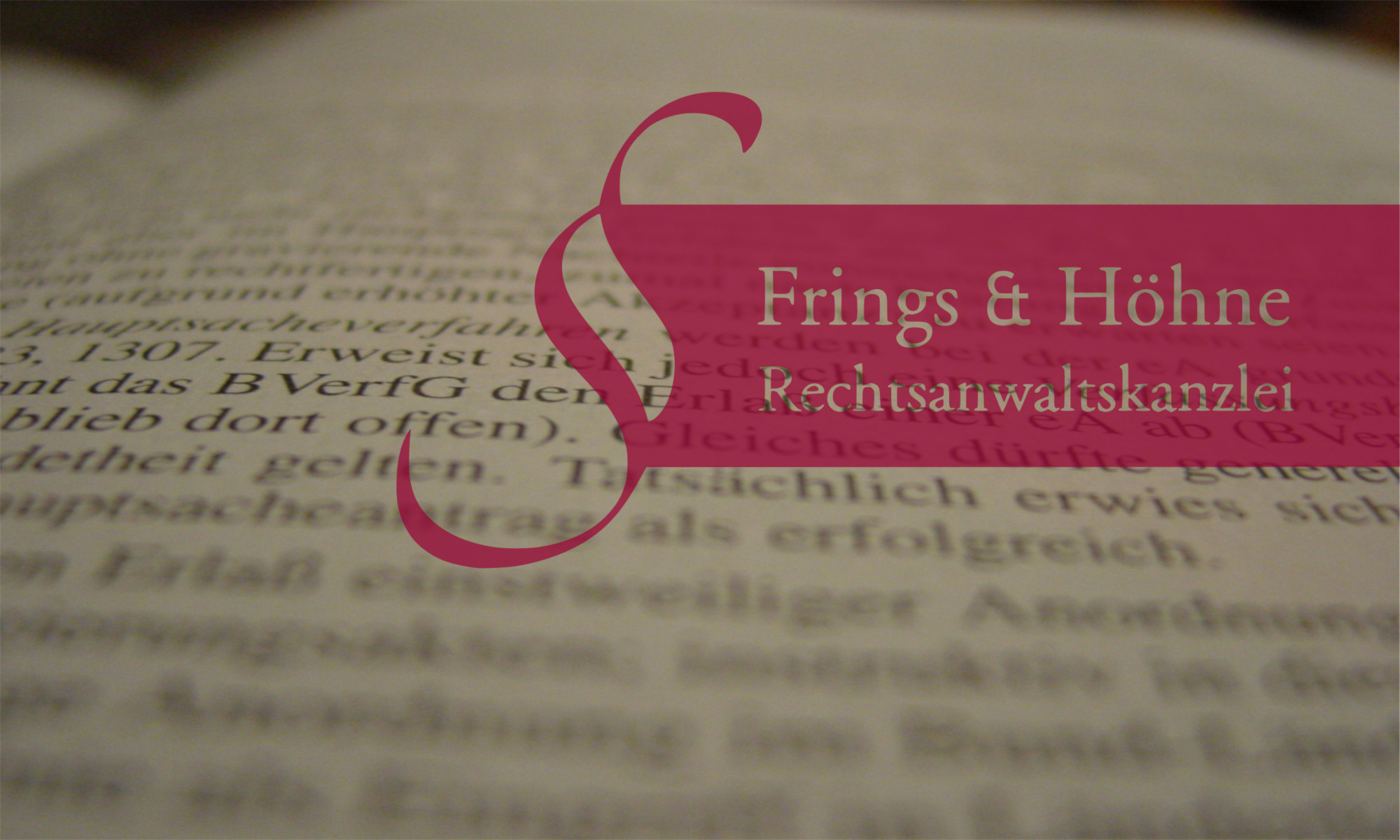Das Amtsgericht Dresden entschied mit Urteil vom 18. März 2025 zugunsten des Klägers gegen die beklagte Versicherung in einem Schadensersatzprozess im Zusammenhang mit einem Fahrzeugbrand. Der Kläger machte Ansprüche auf Freistellung von restlichen Sachverständigenkosten sowie außergerichtlichen Anwaltskosten geltend, nachdem sein Alfa Romeo Giulia durch einen brennenden Smart beschädigt wurde. Die Beklagte war als Haftpflichtversicherung des verursachenden Fahrzeugs grundsätzlich zur Regulierung des Schadens verpflichtet, bestritt jedoch die Höhe der Sachverständigenkosten und verweigerte deren vollständige Erstattung.
Das Gericht folgte der aktuellen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, insbesondere dem Urteil vom 12. März 2024 (VI ZR 280/22), welches die sogenannte Werkstattrisiko-Rechtsprechung auf Sachverständigenkosten überträgt. Demnach trägt die Haftpflichtversicherung des Schädigers grundsätzlich das Risiko, dass die vom Geschädigten beauftragten Sachverständigen möglicherweise höhere Kosten in Rechnung stellen, als es aus Sicht der Versicherung angemessen erscheint. Eine Kürzung dieser Kosten kommt nur dann in Betracht, wenn der Geschädigte hätte erkennen müssen, dass die Gebühren des Sachverständigen erheblich über dem üblichen Marktpreis liegen. Da die Beklagte keine substantiierten Einwendungen dazu erhob, dass der Kläger eine solche Überhöhung hätte erkennen können, entschied das Gericht, dass der Kläger von der Verbindlichkeit gegenüber dem Sachverständigenbüro freizustellen ist. Zudem hatte der Kläger seine möglichen Regressansprüche gegenüber dem Sachverständigen an die Beklagte abgetreten, wodurch die Versicherung in eigener Verantwortung gegen etwaige überhöhte Forderungen des Sachverständigen vorgehen konnte.
Im Weiteren wurde durch das Gericht entschieden, dass es nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs unerheblich ist, ob ein Geschädigter Freistellung von einer Verbindlichkeit oder Zahlung an den Forderungssteller begehrt. Maßgeblich ist, dass er durch den Schädiger wirtschaftlich so gestellt wird, als wäre das schädigende Ereignis nicht eingetreten. Nach § 249 Abs. 1 BGB besteht ein Anspruch auf Naturalrestitution, was sowohl die Zahlung der Schadenssumme als auch die Übernahme einer Verbindlichkeit umfassen kann. Zwar kann der Geschädigte zunächst nur Freistellung verlangen, doch wenn sich der Schädiger oder seine Versicherung ernsthaft weigert, die Kosten zu übernehmen, kann sich der Freistellungsanspruch gemäß § 250 Satz 2 BGB auch in einen Zahlungsanspruch umwandeln. Da die Beklagte die vollständige Regulierung der Sachverständigenkosten verweigerte, hatte der Kläger daher das Recht, Freistellung von der Verbindlichkeit zu fordern.
Auszug aus der Gerichtsentscheidung:
„IM NAMEN DES VOLKES
ENDURTEIL
In dem Rechtsstreit
[…]
– Kläger –
Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Frings & Höhne, Obergraben 7/9, 01097 Dresden, Gz.: […]
gegen
[…] Versicherung[…]
– Beklagte –
Prozessbevollmächtigte:
[…]
wegen Schadensersatz
hat das Amtsgericht Dresden
durch Richterin […]
im schriftlichen Verfahren gemäß § 128 Abs. 2 ZPO am 18.03.2025
für Recht erkannt:
1. Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger gegenüber
a. dem Kfz-Sachverständigenbüro […] Zug um Zug gegen Abtretung der Ansprüche aus der Rechnung vom 13.02.2024 […] von restlichen Forderungen in Höhe von 985,80 € aus der Rechnung […] vom 13.2.2024 freizustellen.
b. den Rechtsanwälten Frings & Höhne, Obergraben 7/9, 01097 Dresden von der Forderung der restlichen außergerichtlichen Kosten in Höhe von 80,45 € freizustellen.
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte kann die Vollstreckung durch den Kläger gegen Sicherheitsleistung i.H.v. 120 % des vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.
Beschluss:
Der Streitwert wird auf 991,80 EUR festgesetzt.
Tatbestand
Der Kläger beanspruchten restlichen Schadenersatz aufgrund eines Fahrzeugbrandes vom 26.1.2024 gegen 19:20 Uhr beim Brandort […] in Dresden.
Der Kläger war zum Unfallzeitpunkt Eigentümer des Pkws Alfa Romeo Giulia mit dem amtlichen Kennzeichen […] und der Fzg.Ident.Nr. […].
Die Beklagte ist die am Brandtag bestehende Haftpflichtversicherung des brandauslösenden Pkws Smart mit dem amtlichen Kennzeichen […], durch welches der klägerische Pkw beschädigt wurde.
Mit der Klage beansprucht der Kläger folgende Sachschäden:
a. Die Gutachterkosten gemäß der als Anlage K 4 vorgelegten Rechnung […] des Kfz-Sachverständigenbüros […] vom 13.2.2024: 1.420,15 €.
Die Beklagte hat hierauf 6 € und weitere 428,35 € gezahlt. Der Kläger beansprucht die Zahlung weiterer 991,80 €.
Darüber hinaus beansprucht der Kläger die Erstattung weiterer außergerichtlicher Rechtsanwaltskosten aus einem Gegenstandswert i.H.v. 13.954,15 € unter Zugrundelegung einer 1,3 Geschäftsgebühr zuzüglich einer Auslagenpauschale i.H.v. 20 € sowie 19 % Umsatzsteuer hieraus in Höhe von gesamt 1134,55 €, worauf die Beklagte 1.054,10 € gezahlt hat, somit weitere 80,45 €.
Der Kläger hat die Abtretung etwaiger Ansprüche des Klägers bezüglich der Vergütungsforderung aus der Rechnung 13.02.2024 […] gegenüber dem Kfz-Sachverständigenbüro […] an die Beklagte erklärt.
Der Kläger ist der Auffassung,
das nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 12. März 2024 (Az. VI ZR 280/22) die Sachverständigenkosten von der Beklagten vollumfänglich an den Sachverständigen zu erstatten seien, da diese das „Werkstattrisiko“ zu tragen habe. Es würde rechtlich keinen Unterschied machen, ob der Geschädigte Freistellung oder Zahlung verlangen würde, da beide Varianten darauf abzielen würden, den Geschädigten durch eine Zahlung des Schädigers bzw. dessen Haftpflichtversicherung an den Sachverständigen wirtschaftlich so zu stellen, wie er ohne das schädigende Ereignis gestanden hätte.
Der Kläger bei hat zuletzt beantragt:
Die Beklagte wird verurteilt, den Kläger gegenüber
a. dem Kfz-Sachverständigenbüro […] Zug um Zug gegen Abtretung der Ansprüche aus der Rechnung vom 13.02.2024 […] von restlichen Forderungen in Höhe von 991,80 € aus der Rechnung […] vom 13.2.2024 freizustellen.
b. den Rechtsanwälten Frings & Höhne, Obergraben 7/9, 01097 Dresden von der Forderung der restlichen außergerichtlichen Kosten in Höhe von 80,45 € freizustellen.
Die Beklagte beantragt:
Klageabweisung
Die Beklagte ist der Auffassung,
dass die Sachverständigenkosten überhöht und nicht zu erstatten seien.
Die geltend gemachten Sachverständigenkosten von 1.420,15 € seien nicht erforderlich. Erforderlich und ortsüblich seien allenfalls 434,35 € .
Nach der Rechtsprechung des BGHs vom März 2024 könne sich der Geschädigte nur dann auf das Sachverständigenrisiko berufen, wenn er Zahlung der noch offenen Reparaturkosten an den Sachverständigen verlangt. Die beantragte Freistellung von Sachverständigenkosten würde nach dieser Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht genügen.
Im Übrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen.
Entscheidungsgründe
Der Kläger beansprucht die Freistellung von der Verbindlichkeit der Sachverständigenkosten.
Der Antrag des Klägers ist in dem zuletzt gestellten Antrag im vollen Umfang gemäss der § 7 StVG, 823 Abs. 1 BGB, 115 VVG begründet.
1.
Auch soweit der Kläger nicht Zahlung an den Sachverständigen sondern Freistellung von seiner Verbindlichkeit gegenüber dem Sachverständigen beansprucht, ist sein Anspruch entsprechend der Rechtsprechung des BGHs zum Werkstattrisiko in vollem Umfang begründet. Eine weitergehende Überprüfung der Angemessenheit und Erforderlichkeit der Sachverständigenkosten erübrigt sich daher, da die Beklagte das Sachverständigenrisiko zu tragen hat, der Kläger ausdrücklich die Abtretung eventueller Regressansprüche gegenüber dem Sachverständigen erklärt hat und substantiierte Einwendungen in Hinblick auf die Verletzung der Schadensminderungspflicht des Klägers – Z.B. bei der Auswahl des Sachverständigen oder in Bezug auf die Erkennbarkeit eine Überhöhung der Sachverständigenkosten – durch die Beklagte nicht erhoben wurden.
2.
Der Einwand der Beklagten ist nicht begründet, sofern sie der Auffassung ist, das bei einem Freistellungsantrag die Rechtsprechung des BGHs in Bezug auf das Sachverständigenrisiko nicht übertragbar sei.
Auch in dem Fall des Freistellungsantrags ist “für die schadensrechtliche Betrachtung (§ 249 BGB) des Verhältnisses zwischen Geschädigtem und Schädiger die werkvertragliche Beziehung (§§ 631 ff. BGB) zwischen Geschädigtem und Sachverständigem maßgeblich. Denn der Geschädigte, der in Wahrnehmung seiner Ersetzungsbefugnis (§ 249 Abs. 2 Satz 1 BGB) berechtigter Weise ein Schadensgutachten bei einem Sachverständigen in Auftrag gibt, muss vom Schädiger die Freistellung von der ihm hieraus gegenüber dem Sachverständigen entstehenden Verbindlichkeit verlangen können, soweit dessen Vergütungsanspruch nicht auch für den Geschädigten erkennbar überhöht war.“ (BGH, Urteil vom 13. Dezember 2022 – VI ZR 324/21 –, Rn. 12, juris)
Nach der Rechtssprechung des BGHs kann der Geschädigte, sofern er Zahlung geleistet hat, Zahlung an sich selbst beanspruchen und – sofern er sich auf das Werkstattrisiko beruft Zug um Zug gegen Abtretung eventueller Ansprüche gegen den Sachverständigen.
Sofern der Geschädigte die Rechnung nicht beglichen hat, kann er – will er das Werkstattrisiko bzw. hier das Sachverständigenrisiko nicht selbst tragen – die Zahlung der Sachverständigenkosten allerdings nicht an sich, sondern nur an den Sachverständigen verlangen, Zug um Zug gegen Abtretung etwaiger (dieses Risiko betreffender) Ansprüche des Geschädigten gegen den Sachverständigen, BGH, Urteil vom 12. März 2024 – VI ZR 280/22 –, Rn. 16 – 18, juris.
Grundsätzlich gilt, dass der Geschädigte vor Bezahlung lediglich Freistellung (§ 257 BGB) verlangen kann, welcher sich jedoch nach § 250 Abs.2 BGB zu einen Zahlungsanspruch umwandelt, „wenn sich der Schädiger oder seine Haftpflichtversicherung ernsthaft weigert, Schadensersatz zu leisten (BGH NJW 2004, 1868; NJW-RR 2011, 910 jew. m. w. N.), was auch in einem entsprechenden prozessualen Verhalten (z.B. einem Klageabweisungsantrag) liegen kann (BGH NJW-RR 2011, 910) und der Geschädigte sich nicht auf einen Freistellungsanspruch nach § 257 BGB verweisen lassen muss (BGH NJW 1970, 1122 mit weiteren Nachweisen…), weil sich dieser gem. § 250 S. 2 BGB in einen Zahlungsanspruch verwandelt hat (BGH a.a.O.; LG Hamburg a.a.O.; AG München, Urt. vom 03.04.2009 -343 C 15534/08 [juris, dort Rz. 28]; AG Karlsruhe NZV 2005, 326 = SP 2005, 144 = zfs 2005, 309 = AGS 2005, 253 = JurBüro 2005, 194; AG Kaiserslautern DV 2014, 238 ff.),“ (OLG München, Beschluss vom 12. März 2015 – 10 U 579/15 –, Rn. 39, juris).
Zahlungsanspruch und Freistellungsanspruch betreffen daher den gleichen Anspruch des Geschädigten der auf der werkvertragliche Beziehung (§§ 631 ff. BGB) zwischen Geschädigtem und Sachverständigem beruht, wobei sich der ursprüngliche Herstellungsanspruch – Befreiung von einer Verbindlichkeit – nach § 250 Satz 2 BGB in einen Zahlungsanspruch an sich selbst umwandelt.
Damit entspricht der Anspruch auf Befreiung von der Verbindlichkeit gegenüber dem Sachverständigen dem Grunde nach dem Anspruch auf Zahlung an den Sachverständigen und sind die gleichen von dem BGH entwickelten Grundsätze zur Regulierung des Folgeschadens in Form der Sachverständigenkosten heranzuziehen, wenn sich der Geschädigte auf das Werkstattrisiko beruft.
3.
Der Anspruch des Klägers ist jedoch der Höhe nach zu kürzen.
Die Sachverständigenkosten betragen 1420,15 €. Die Beklagte hat hierauf 6 € und weitere 428,35 € gezahlt. Der Kläger hat daher lediglich i.H.v. 985,80 € einen Anspruch auf Befreiung von den Sachverständigenkosten.
4.
Der Anspruch auf Erstattung weiterer außergerichtlicher Rechtsanwaltskosten nach §§ 280, 286, 249 BGB folgt aus dem erhöhten Gebührenwert und ist des Weiteren nicht von der Beklagten substantiiert angegriffen worden.
5.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 ZPO, der Ausspruch bezüglich der vorläufigen Vollstreckbarkeit beruht auf den §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO.“
AG Dresden, Urteil vom 18. März 2025 – 114 C 3511/24