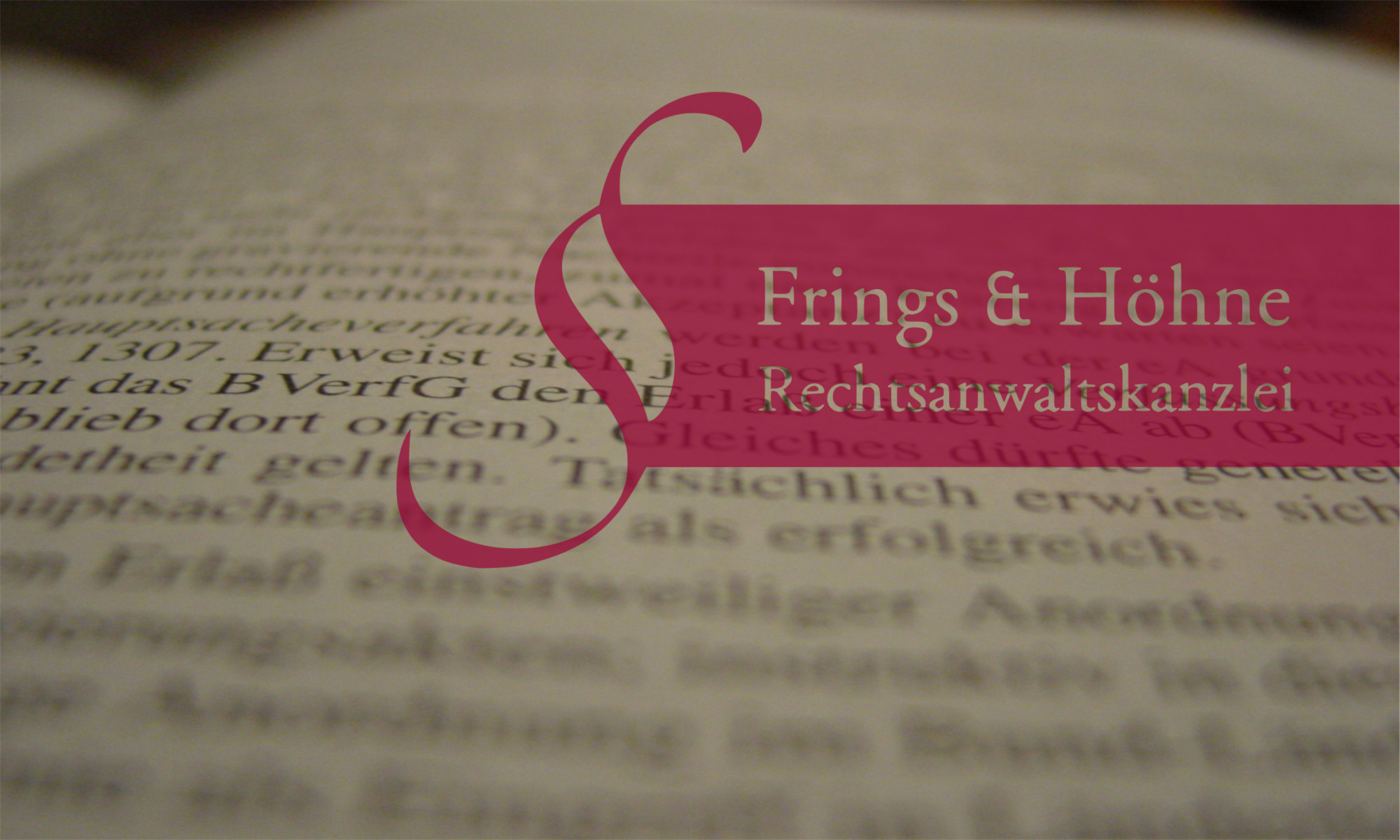Durch das Landgericht Hildesheim (LG Hildesheim, Beschluss vom 9.8.2018 – 26 Qs 56/18) wurde entschieden, dass dem Betroffenen die Erstattung der ihm entstandenen Auslagen grundsätzlich nicht versagt werden darf, wenn das Ordnungswidrigkeitenverfahren ohne die Durchführung einer Hauptverhandlung eingestellt wird.
Auszug aus der Gerichtsentscheidung:
„Beschluss
In dem Bußgeldverfahren
gegen: […],
Verteidiger: Rechtsanwalt Stephan M. Höhne, Bautzen,
hat die Strafkammer 16 – als 6. Kammer für Bußgeldsachen – des Landgerichts Hildesheim auf die sofortige Beschwerde der Staatsanwaltschaft Hildesheim vom 09.07.2018, bei Gericht eingegangen am 11.07.2018, gegen den Beschluss des Amtsgerichts Gifhorn vom 04.07.2018 (75 OWi 32 Js 9675/18), der Staatsanwaltschaft zugestellt am 05.07.2018 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin am Landgericht […], des Richters am Landgericht […] und der Richterin […] am 09.08.2018 beschlossen:
Die sofortige Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen die Kosten- und Auslagenentscheidung in dem Beschluss des Amtsgerichts Gifhorn vom 04.07.2018 (75 OWi 32 Js 9675/18) wird verworfen.
Die Kosten des Beschwerdeverfahrens und die der Betroffenen
insoweit entstandenen notwendigen Auslagen fallen der Landeskasse
zur Last.
Gründe:
I.
Dem Betroffenen wurde vorgeworfen, eine Verkehrsordnungswidrigkeit nach § 24 StVG (Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 59 km/h). Mit Bußgeldbescheid vom 07.09.2017, dem Betroffenen zugestellt am 13.09.2017, hat der Landkreis Gifhorn dem Betroffenen eine Geldbuße in Höhe von 240,00 € auferlegt sowie ein einmonatiges Fahrverbot verhängt. Hiergegen hat der Betroffene über seinen Verteidiger rechtzeitig Einspruch eingelegt. Einlassungen zur Sache sind dahingehend erfolgt, dass der Betroffene im
Rahmen der Anhörung angab, der Fahrzeugführer gewesen zu sein. Den Verstoß gab er allerdings nicht zu.
Die Akten sind nach dem Einspruch vom 20.09.2017 und einem weiteren Schreiben des Verteidigers vom 04.10.2017 ohne erkennbaren Grund erst am 06.03.2018 an die Staatsanwaltschaft abgesandt worden, wo die Akten erst nach Verjährungseintritt am 08.03.2018 eingingen. Der Eingang der Akten bei Gericht war schließlich erst am 04.05.2018. Mit Beschluss vom 04.07.2018 (75 OWi 32 Js 9675/18) hat das Amtsgericht Gifhorn das Verfahren wegen Verjährungseintritts gemäß §§ 46 OWiG, 206 a StPO eingestellt und die Kosten des Verfahrens einschließlich der notwendigen Auslagen des Betroffenen der Landeskasse auferlegt.
Mit Verfügung vom 09.07.2018 hat die Staatsanwaltschaft Hildesheim daraufhin sofortige Beschwerde gegen die Kostenentscheidung aus dem Beschluss des Amtsgerichts Gifhorn vom 04.07.2018 (75 OWI 32 Js 9675118) eingelegt. Zur Begründung wurde ausgeführt, dass von einer Auslagenerstattung abgesehen werden könne, wenn ein hinreichender Tatverdacht fortbestehe. Dies sei anhand der vorliegenden Beweismittel der Fall.
II.
Der als „Beschwerde“ bezeichnete Rechtsbehelf der Staatsanwaltschaft ist als das statthafte Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde anzusehen. Diese auf die Kostenentscheidung beschränkte sofortige Beschwerde ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg.
Das Amtsgericht hat die notwendigen Auslagen des Betroffenen bei der Einstellung des Verfahrens wegen eines Verfahrenshindernisses gemäß §§ 46 OWiG, 467 Abs.1 StPO zurecht der Landeskasse auferlegt hat.
1.
Grundsätzlich kann das Gericht nach § 467 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 StPO im Fall einer solchen Einstellung davon absehen, die notwendigen Auslagen der Betroffenen der Landeskasse aufzuerlegen, wenn eine Verurteilung nur deshalb nicht erfolgt, weil ein Verfahrenshindernis besteht. Dies erfordert eine zweistufige Prüfung. Zunächst ist der Verdachtsgrad zu erörtern, bei welchem davon ausgegangen werden kann, dass eine Verurteilung nur aufgrund des Verfahrenshindernisses nicht erfolgt ist. In einem zweiten Schritt hat das Tatgericht sein Ermessen dahingehend auszuüben, ob eine
Kosten- und Auslagenentscheidung zum Nachteil des Angeklagten ergehen kann (vgl. OLG Celle StraFo 2014, 438-440)
Die konkrete Situation, wann eine Verfolgung allein aufgrund des
Verfahrenshindernisses nicht erfolgt, ist in der Rechtsprechung umstritten. Nach einer Auffassung kommt eine Versagung der Auslagenerstattung nur dann in Betracht, wenn bei Hinwegdenken des Verfahrenshindernisses mit Sicherheit eine Verurteilung zu erwarten gewesen wäre (vgl. Karlsruher Kommentar, StPO, 7. Auflage 2013, § 467 Rn. 10a m.w.N.; vgl. u.a. BGH NJW 1995, 1297, 1301; OLG Celle wistra 2011, 239f.; OLG Hamm wistra 2006, 359). Nach einer anderen Auffassung in der Rechtsprechung ist eine Ermessensentscheidung hingegen schon dann eröffnet, wenn zur Zelt der Feststellung des Verfahrenshindernisses ein zumindest hinreichender Tatverdacht besteht und keine Umstände vorliegen, die bei weiterer Hauptverhandlung eine Konkretisierung des Tatverdachts bis zur
Feststellung der Schuld in Frage stellen (vgl. OLG Celle StraFo 2014, 438-440
m.w.N.). Letztere Auffassung wird allerdings dann zur Anwendung gebracht, wenn eben schon eine Hauptverhandlung weitgehend fortgeschritten oder abgeschlossen ist. Für diese Auffassung ist im vorliegenden Fall daher schon nach den Grundgedanken der Strafprozessordnung kein Raum, weil eine Hauptverhandlung, in der der Betroffene Umstände, die einen Verstoß in Frage stellen könnten, vorbringen könnte, gar nicht stattgefunden hat.
Um eine tragfeste Aussage über Verdachtsgrad und die Schuld in Zweifel ziehende Umstände treffen zu können, muss wegen der mit einer belastenden Auslagenentscheidung verbundenen Feststellung und Zuweisung strafrechtlicher Schuld zuvor die Hauptverhandlung bis zur Schuldspruchreife, zumindest aber weitgehend genug für eine tragfeste Grundlage, durchgeführt worden sein. Vor Erreichen dieses Verfahrensstadiums ist von dieser Warte aus für eine Auslagenentscheidung nach § 467 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 StPO kein Raum (BVerfG, Kammerbeschluss vom 16. Dezember 1991 – 2 BvR 1590/89 – NJW 1992, 1611). Dies ist schon allein deswegen nachvollziehbar, weil allein ein Akteninhalt nicht Grundlage einer Entscheidung über die Schuldfrage sein darf. Vielmehr sieht die Strafprozessordnung die Durchführung einer Hauptverhandlung für strafrechtliche Schuldfeststellungen vor. Diese Verfahrensgrundsätze gelten auch für Bußgeldverfahren. Ohne diese Grundsätze würde ein Betroffener, der von dem ihm zustehenden Schweigerecht Gebrauch machen möchte benachteiligt. Ein Betroffener, der dagegen aus freien Stücken zu seiner Verteidigung Umstände vorbringt, die eine Verurteilung unwahrscheinlich machen, wäre dagegen im Vorteil,
obwohl der schweigende Betroffene lediglich seine strafprozessualen Rechte wahrnimmt.
Vorliegend kann daher aufgrund des bisherigen Verfahrensgangs ohne eine
Hauptverhandlung somit gerade nicht die Prognose getroffen werden, dass der Betroffene ohne das Vorliegen des Verfahrenshindernisses mit Sicherheit verurteilt worden wäre. Eine separate Beweiserhebung im Rahmen des Verfahrens über die Kosten verbietet sich (BVerfG NJW 1991, 829).
2.
Doch selbst wenn man die Meinung vertreten würde, § 467 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 StPO wäre vorliegend anwendbar, so käme auch im Rahmen der nunmehr
durchzuführenden Ermessensentscheidung ein Absehen von der Auslagenerstattung nicht in Betracht. Das Gericht hätte nämlich dann zu prüfen, ob auf Grund besonderer Umstände die Belastung der Landeskasse mit den Auslagen des Betroffenen als unbillig erscheint. In der voraussichtlichen Verurteilung des Betroffenen und der zugrunde liegenden Tat dürfen derartige besondere Umstände aber allein nicht gesehen werden.
Es ist umstritten, ob regelmäßig ein vorwerfbares prozessuales Fehlverhalten des Betroffenen hinzutreten muss (so z.B. Meyer-Goßner. StPO, 56. Auflage 2013, § 467 Rn. 18 aE; Karlsruher Kommentar, StPO, 7. Auflage 2013, § 467 Rn. 10b mit zahlreichen Nachweisen aus der Rechtsprechung; andere Ansicht OLG Gelle StraFo 2014, 438 – 440). Wenngleich dieses hier nicht gegeben war, kann dies auch dahinstehen, weil es schon nicht unbillig ist, die Landeskasse mit den Auslagen des
Betroffenen zu belasten.
Vorliegend beruht das Verfahrenshindernis auf einer Verzögerung des Verfahrens durch den Landkreis Gifhorn. Eine Verurteilungswahrscheinlichkeit ergibt sich insbesondere nicht schon durch die Einräumung der Fahrzeugführereigenschaft des Betroffenen. Hierfür wäre vielmehr auch die Feststellung einer ordnungsgemäßen
Messung erforderlich, was durch den Betroffenen in einem umfangreichen
Schriftsatz angegriffen wurde. Wenngleich in dem Bußgeldverfahren durch das standardisierte Messverfahren grundsätzlich vereinfachte Verfahrensgrundsätze gelten, so würde – wie bereits oben ausgeführt – eine Umgehung der Notwendigkeit einer Hauptverhandlung jedenfalls der Unschuldsvermutung entgegenstehen.
3.
Die Entscheidung über die Kosten- und Auslagen im Beschwerdeverfahren beruht auf § 473 Abs. 1, 2 StPO. Dieser Beschluss ist nicht anfechtbar (§ 310 Abs. 2 StPO).“
LG Hildesheim, Beschluss vom 9.8.2018 – 26 Qs 56/18