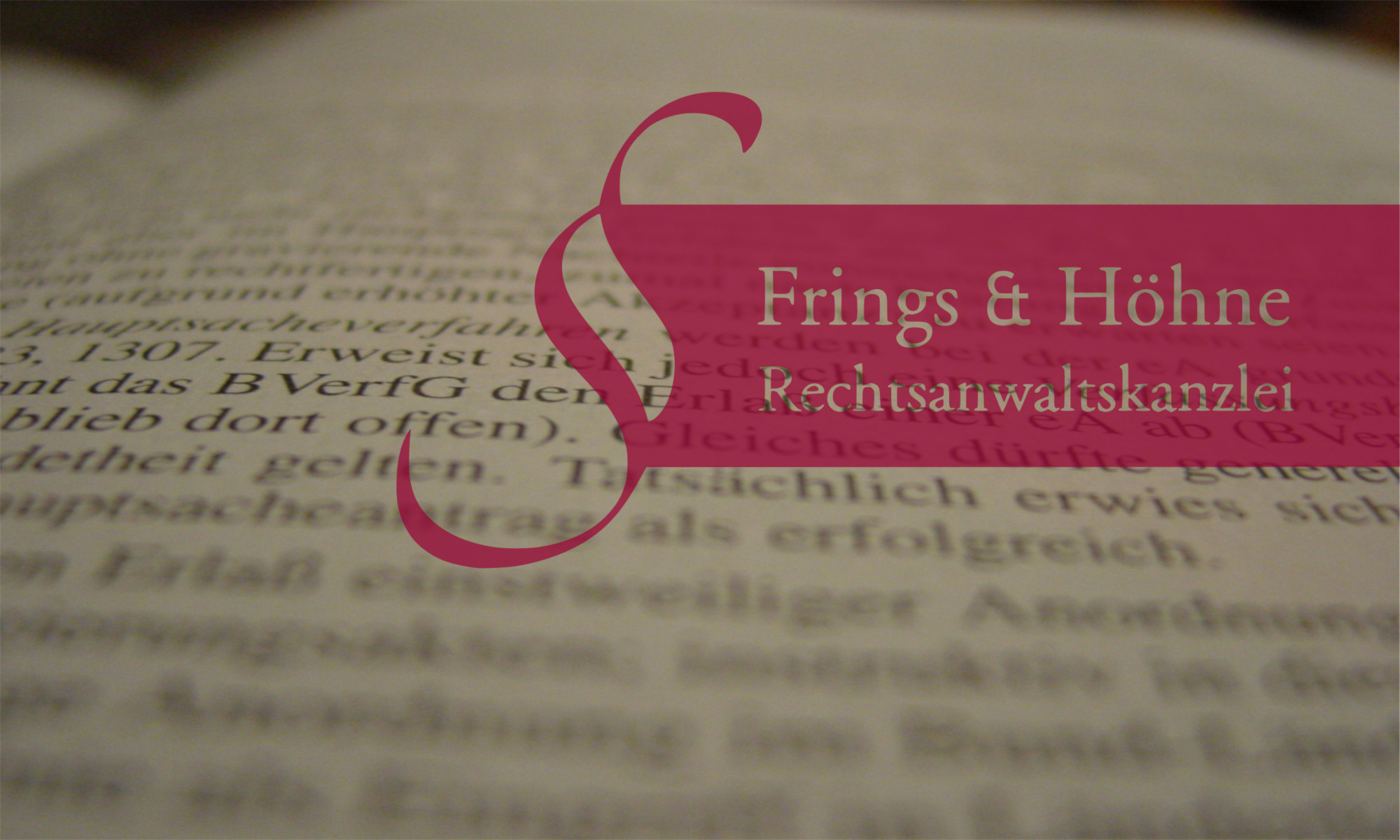Durch das Landgericht Bautzen (LG Bautzen, Beschluss vom 10.8.2011 – 2 O 165/09) wurde hierzu entschieden:
Auszug aus den Entscheidungsgründen:
„Nachdem die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt erklärt haben, war gemäß § 91 a ZPO nur noch über die Kosten des Rechtsstreits zu entscheiden.
Haben die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, so entscheidet das Gericht gemäß § 91 a ZPO über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen.
Vorliegend entspricht es billigem Ermessen, die Kosten des Verfahrens wie tenoriert zu quoteln.
Die Klägerin konnte das Bestehen vertraglicher Ansprüche nicht beweisen, da sie das Zustandekommen wirksamer Verträge nicht beweisen konnte. […]
Es hat allerdings nach bisherigem Sach- und Streitstand ein Bereicherungsanspruch in Höhe von 1.259,13 € bestanden.
Die Werkleistungen wurden „durch Leistung“ der Klägerin erlangt. Denn diese handelte in dem Glauben, hierzu der GbR gegenüber verpflichtet zu sein. Die Beweisaufnahme hat ergeben, dass die Klägerin beide der GbR gehörenden Wohnungen renoviert hat, und zwar nicht für den Gesellschafter […], sondern für die GbR. […]
Der Bereicherungsanspruch ist nicht gem. § 814 BGB wegen Leistung in Kenntnis der Nichtschuld ausgeschlossen. Die Beklagten behaupten nicht, die Klägerin habe gewusst, dass keine wirksamen Werkverträge geschlossen worden seien. Zudem hat die Beweisaufnahme gezeigt, dass die Klägerin in dem Glauben handelte, zu den Sanierungen der GbR gegenüber vertraglich verpflichtet gewesen zu sein.
Gemäß § 818 Abs. 2 BGB ist Wertersatz zu leisten. Für die Höhe des Bereicherungsanspruchs kommt es vorliegend nicht auf die objektiv bemessene Steigerung des Verkehrswertes des Grundstücks an. Zwar stellt die Rechtsprechung des BGH beim Bau auf fremdem Grund und Boden grundsätzlich auf eine solche Wertermittlung ab. Eine solche Wertermittlung würde jedoch nicht den Grundsätzen von Treu und Glauben entsprechen. Die Bereicherungsansprüche gehören dem Billigkeitsrecht an und stehen daher im besonderen Maße unter den Grundsätzen von Treu und Glauben (vgl. BGH Urteil vom 26. 04. 01, Aktenzeichen VIIZR 222/99, zitiert nach JURIS). Auch bei Renovierung einer Mietwohnung durch den Mieter in Unkenntnis der Unwirksamkeit der Schönheitsreparaturklausel ist nicht auf die dadurch eingetretene Wertsteigerung, sondern auf den Wert der erbrachten Dienst- oder Werkleistung abzustellen (vgl. BGH Urteil v. 27.5.2009, AZ: VIII ZR 302/07).
Vorliegend glaubte sich die Klägerin ebenfalls zur Werkleistung verpflichtet.
Die von der Klägerin angesetzten Preise werden von den Beklagten nicht substantiiert angegriffen, so dass diese herangezogen werden können.
Teilweise mit Erfolg berufen sich die Beklagten auf den Einwand der aufgedrängten Bereicherung. Dieser führt zu einer dreifachen Beschränkung des Bereicherungsanspruchs:
Erstens wäre die Haftung auf den jeweiligen Anteil der Beklagten am Gesellschaftsvermögen beschränkt gewesen.
Zweitens war hinsichtlich solcher Leistungen, deretwegen die vormaligen Mieter verurteilt wurden und nun ratenweise gezahlt wird, der Bereicherungsanspruch zu kürzen.
Drittens bestand der Bereicherungsanspruch nur hinsichtlich solcher Leistungen, die zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit unbedingt erforderlich waren. Gemäß § 744 Abs. 2 BGB ist jeder Teilhaber eines gemeinschaftlichen Gegenstandes berechtigt, die zur Erhaltung des Gegenstandes notwendigen Maßregeln ohne Zustimmung der anderen Teilhaber zu treffen; er kann verlangen, dass diese ihre Einwilligung zu einer solchen Maßregel im Voraus erteilen.
Notwendige Erhaltungsmaßregeln sind solche, die im Interesse der Gemeinschaft zur Erhaltung der Substanz oder des wirtschaftlichen Wertes im Rahmen ordnungsgemäßer Verwaltung aus der Sicht eines vernünftigen Teilhabers erforderlich sind; entscheidend ist ein wirtschaftlicher Maßstab unter Berücksichtigung der auch finanziellen Zumutbarkeit für die Teilhaber. Da die GbR vorliegend unstreitig über keine finanziellen Mittel verfügte, kann als notwendige Erhaltungsmaßregel nur das anerkannt werden, was zur Wiederherstellung der Vermietbarkeit unbedingt erforderlich war.
Bei ungerechtfertigter Bereicherung haftet jeder Gesellschafter auf den vollen Betrag, den die GbR nach § 812 BGB schuldet (vgl. Palandt-Sprau, BGB, 70. Aufl. § 714 Rn. 13). […]“
LG Bautzen, Beschluss vom 10.8.2011 – 2 O 165/09